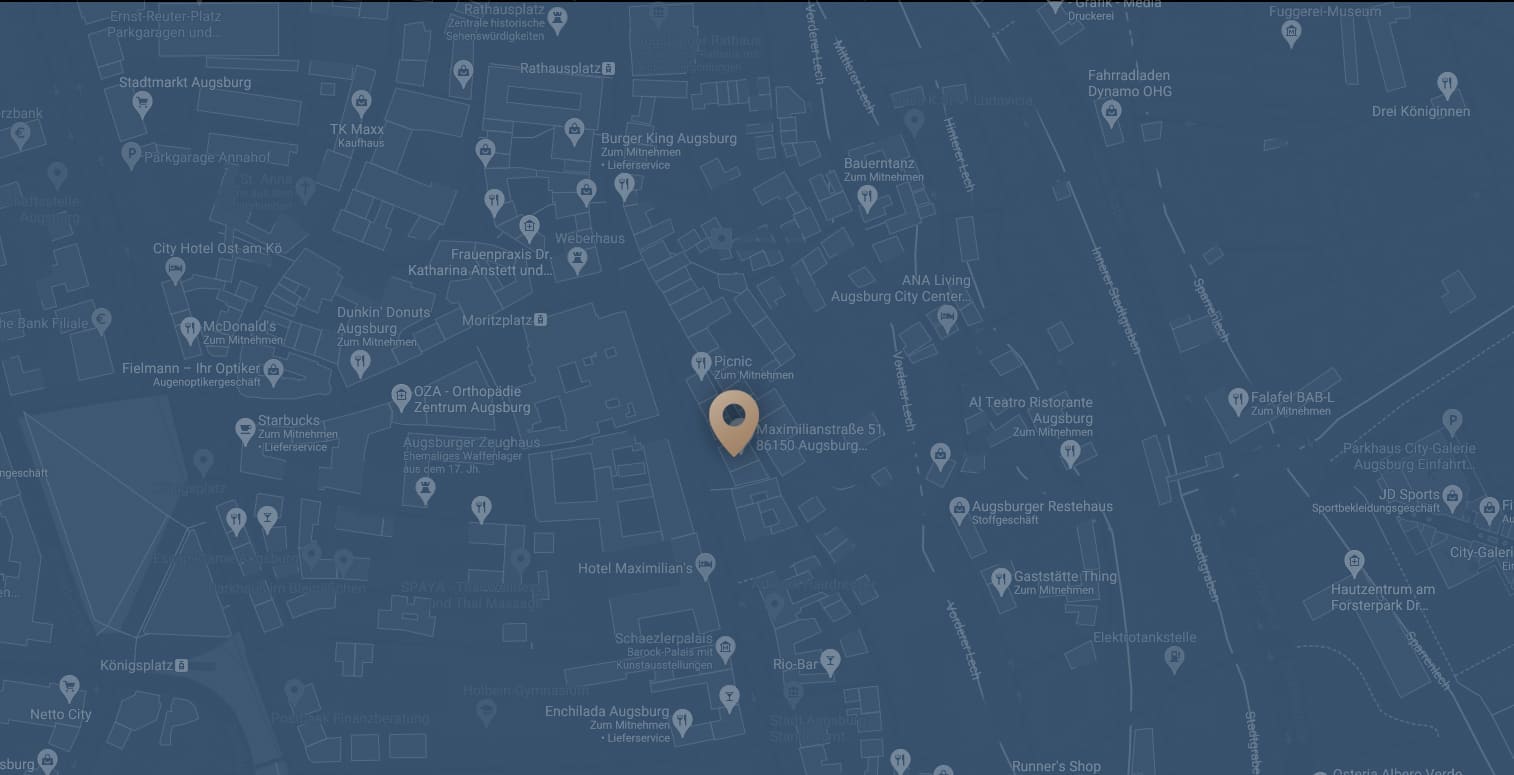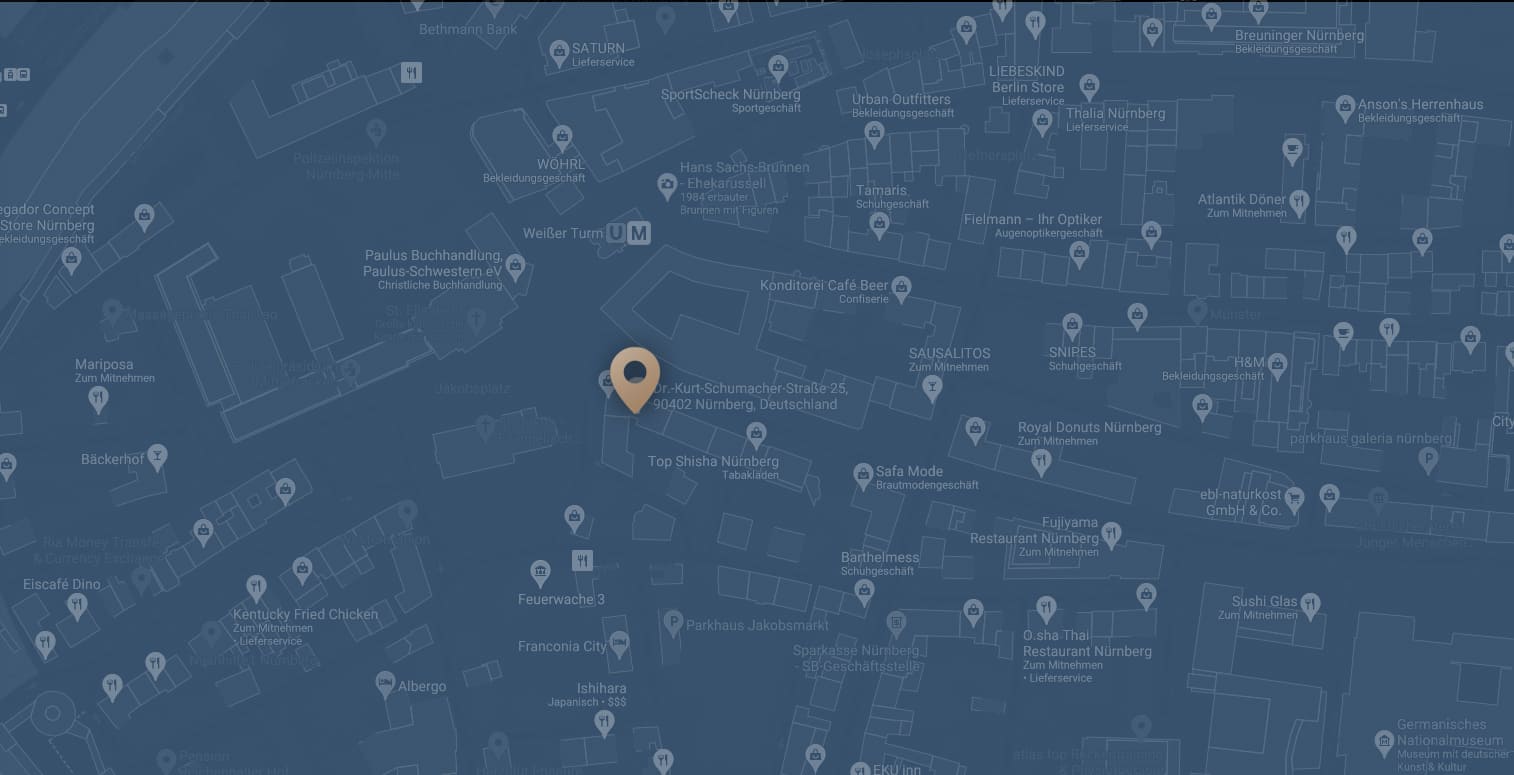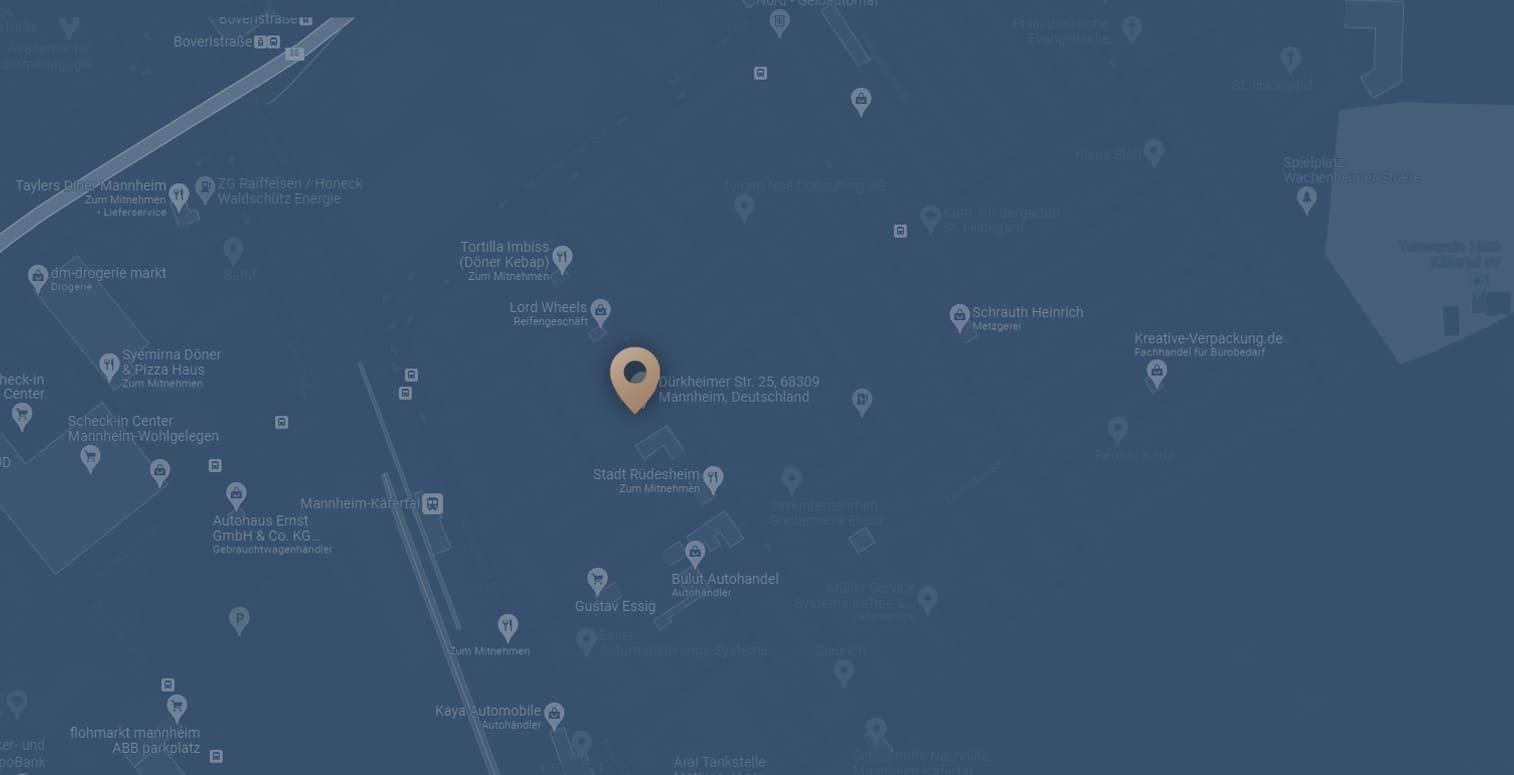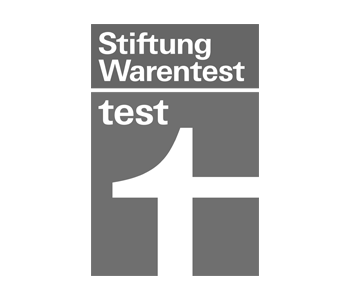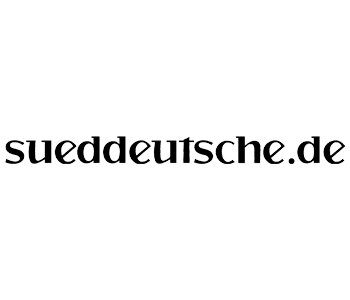Kündigungsschutzklage
Wir kämpfen für Ihr Recht!
IHRE RECHTSANWÄLTE FÜR ARBEITSRECHT UND KÜNDIGUNGSSCHUTZ
- Kostenlose Erstberatung durch Fachanwalt für Arbeitsrecht
- Unproblematische Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail, Fax oder WhatsApp. Sie erreichen ohne Wartezeit direkt Ihren Anwalt, auch am Wochenende, samstags und sonntags.
- Flexible und schnelle Terminvergabe ganz nach Ihren Wünschen. Garantierter Termin noch am selben Tag / binnen 24 Stunden.
- Termine persönlich oder per Microsoft Teams bzw. Skype möglich.
- Intensive und hartnäckige Verfolgung Ihrer Interessen
- Hohe Erfolgsquote
- Spezialisierung unserer Kanzlei auf Arbeitsrecht
- Vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung


11.10.2023 Trainerwechsel FC Augsburg: Arbeitsrechtliche Einschätzung zur Freistellung Maaßens
Mehr erfahren
25.10.2023 Skurriles Arbeitsrecht: Volljurist in Bewerbung „auf Bahnhofspennerniveau verharzt“
Mehr erfahrenKündigungsschutzklage
Will sich der Arbeitnehmer gegen seine Kündigung wehren, muss er Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht erheben. Diese ist – bis auf wenige Ausnahmen – zwingend binnen drei Wochen nach Erhalt der Kündigung zu erheben (§ 4 KSchG). Diese 3-Wochenfrist gilt im Übrigen unabhängig davon, ob das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) überhaupt anwendbar ist, sie gilt also auch bei Kündigungen von Kleinbetrieben.
- Kostenlose Erstberatung
- Mögliche Kostenübernahme für das Verfahren bei Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung
- Arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung im Arbeitsrecht, daher hohe Erfolgsaussichten
- Primäres Anliegen ist eine Weiterbeschäftigung oder Wiedereinstellung
- Häufige Vergleichsaushandlung mit potenzieller Abfindung
- Urlaubsabgeltung bei noch vorhandenen Urlaubstagen
- Überstundenabgeltung
- Forderung eines angemessenen und guten Arbeitszeugnisses
Kostenlose Erstberatung
Manchmal muss es schnell gehen. Rufen Sie uns einfach mit Ihrem Anliegen an oder hinterlassen Sie uns eine Rückrufnachricht. Sie erhalten von uns eine kostenlose und unverbindliche telefonische Erstberatung durch einen Rechtsanwalt. Noch bevor es zu einer Mandatsübernahme kommt, erhalten Sie eine Ersteinschätzung, erläutern Ihre Möglichkeiten und klären Sie auch über die zu erwartenden Kosten auf.
Erst wenn Sie sich im Anschluss der Erstberatung dazu entschließen uns mit Ihrer Vertretung zu beauftragen, entstehen Rechtsanwaltsgebühren. Gerne informieren wir Sie auch über die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe.
Mögliche Kostenübernahme für das Verfahren bei Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung
Wenn Sie über eine Rechtschutzversicherung verfügen, werden die Rechtsanwaltsgebühren grundsätzlich von der Rechtsschutzversicherung übernommen. Sie müssen lediglich eine gegebenenfalls vereinbarte Selbstbeteiligung tragen.
Arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung im Arbeitsrecht, daher hohe Erfolgsaussichten
Der Kündigungsschutz hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Die Kündigungsmöglichkeiten des Arbeitgebers sind stark eingeschränkt, sofern es sich nicht um einen Kleinbetrieb oder eine Probezeitkündigung handelt. Findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung (regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer in Vollzeit, Beschäftigung länger als 6 Monate) lohnt sich eine Klage in den allermeisten Fällen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum eine Kündigung unwirksam sein kann.
Ziel einer Kündigungsschutzklage
Primär dient die Kündigungsschutzklage dem Ziel festzustellen, ob das Arbeitsverhältnis rechtswirksam durch die Kündigung beendet wurde oder nicht. Somit dient sie grundsätzlich einer Weiterbeschäftigung beim Arbeitgeber. Aber die Kündigungsschutzklage ist auch dann sinnvoll, wenn der gekündigte Arbeitnehmer überhaupt nicht mehr an einer Fortführung des Arbeitsverhältnisses interessiert ist, aber mit der Klage eine Abfindungszahlung erreichen will.
Häufige Vergleichsaushandlung mit potenzieller Abfindung
Abfindungszahlungen im Kündigungsschutzverfahren spielen im Arbeitsgerichtsverfahren eine erhebliche Rolle. Mehr als die Hälfte aller Kündigungsschutzverfahren enden durch einen Vergleich, der fast immer eine Abfindungszahlung an den Arbeitnehmer vorsieht. Da der Arbeitgeber einen einmal gekündigten Arbeitnehmer in der Regel nicht wiedereinstellen will, kauft er sich vom Risiko, dass die Kündigungsschutzklage Erfolg hat, durch Zahlung einer Abfindung frei.
Urlaubsabgeltung bei noch vorhandenen Urlaubstagen
Wenn ein Arbeitsverhältnis endet und der Urlaub nicht vollständig genommen wurde, dann sind die noch vorhandenen Urlaubstage dem Arbeitnehmer abzugelten. Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wandelt sich der Urlaubsanspruch in einen finanziellen Anspruch um und ist somit auszubezahlen.
Forderung eines guten berufsfördernden Arbeitszeugnisses
Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer auf sein Verlangen einen Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Oftmals ist der Arbeitgeber jedoch nach Ausspruch einer Kündigung nicht gewillt ein gutes Arbeitszeugnis dem Arbeitnehmer auszustellen. Mit einer Kündigungsschutzklage kann im Rahmen eines Vergleichsabschlusses zugleich ein gutes berufsförderndes Arbeitszeugnis, mit einer Bedauerns-, Dankes- und Gute-Wünsche-Formel ausgehandelt werden.
Bekannt aus
Wawra & Gaibler Rechtsanwalts GmbH
- Verbraucherschutz und Arbeitsrecht Rechtsanwälte
- Telefon: +49 821 508 788 96
Telefax: +49 821 800 65 600 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 911 2406 1431
Telefax: +49 911 24 06 14 36 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 621 181 459 33
Telefax: +49 621 748 277 94 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de