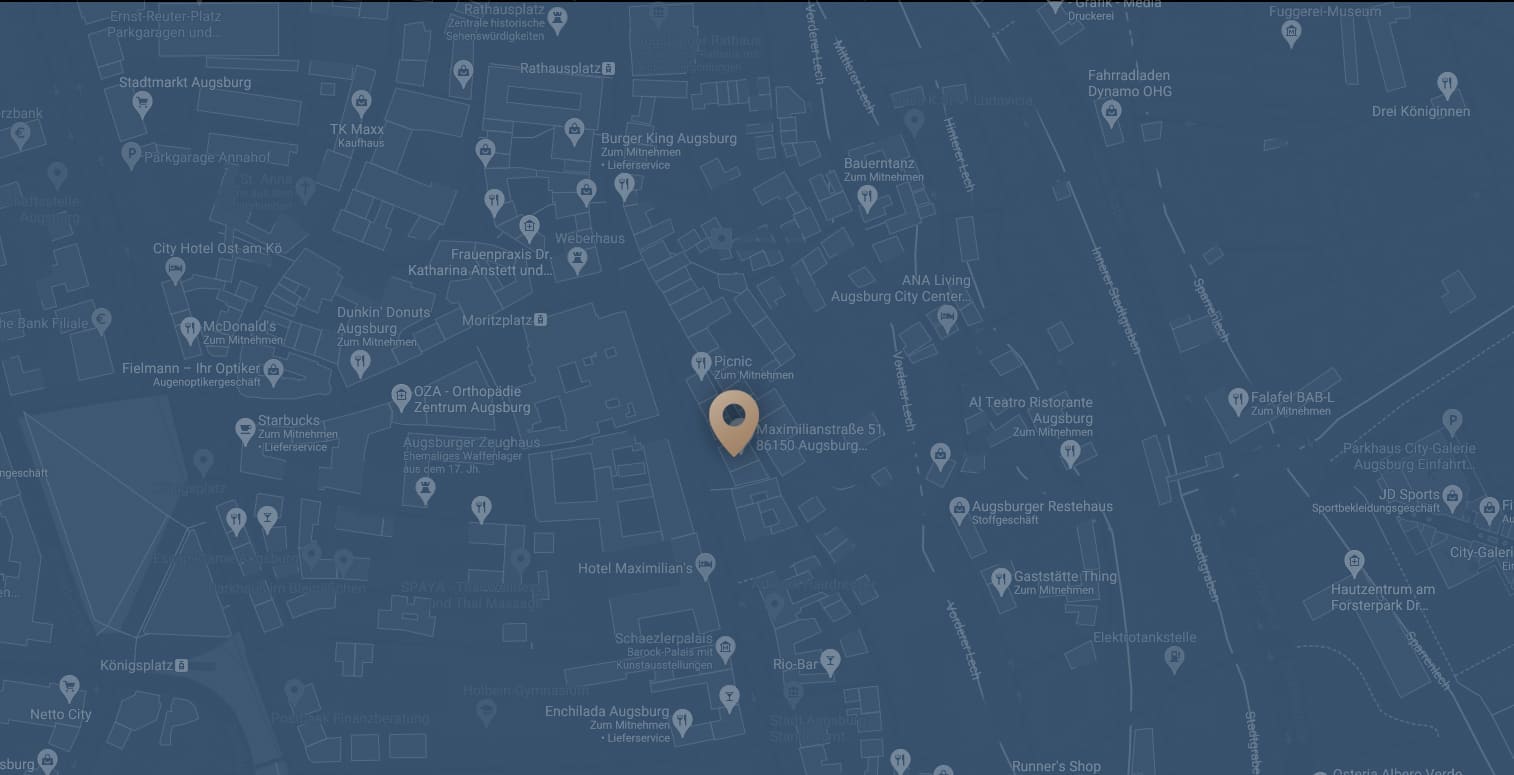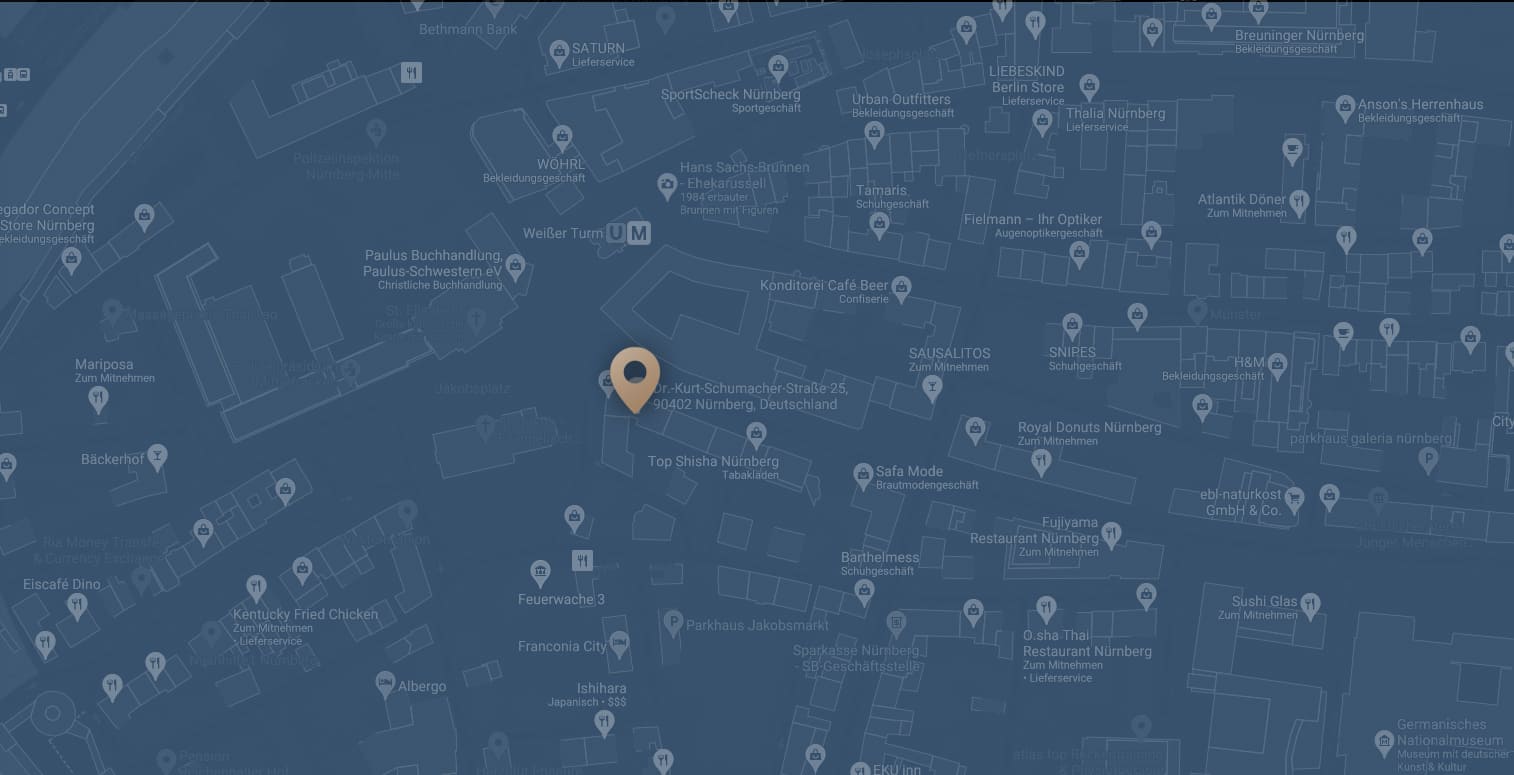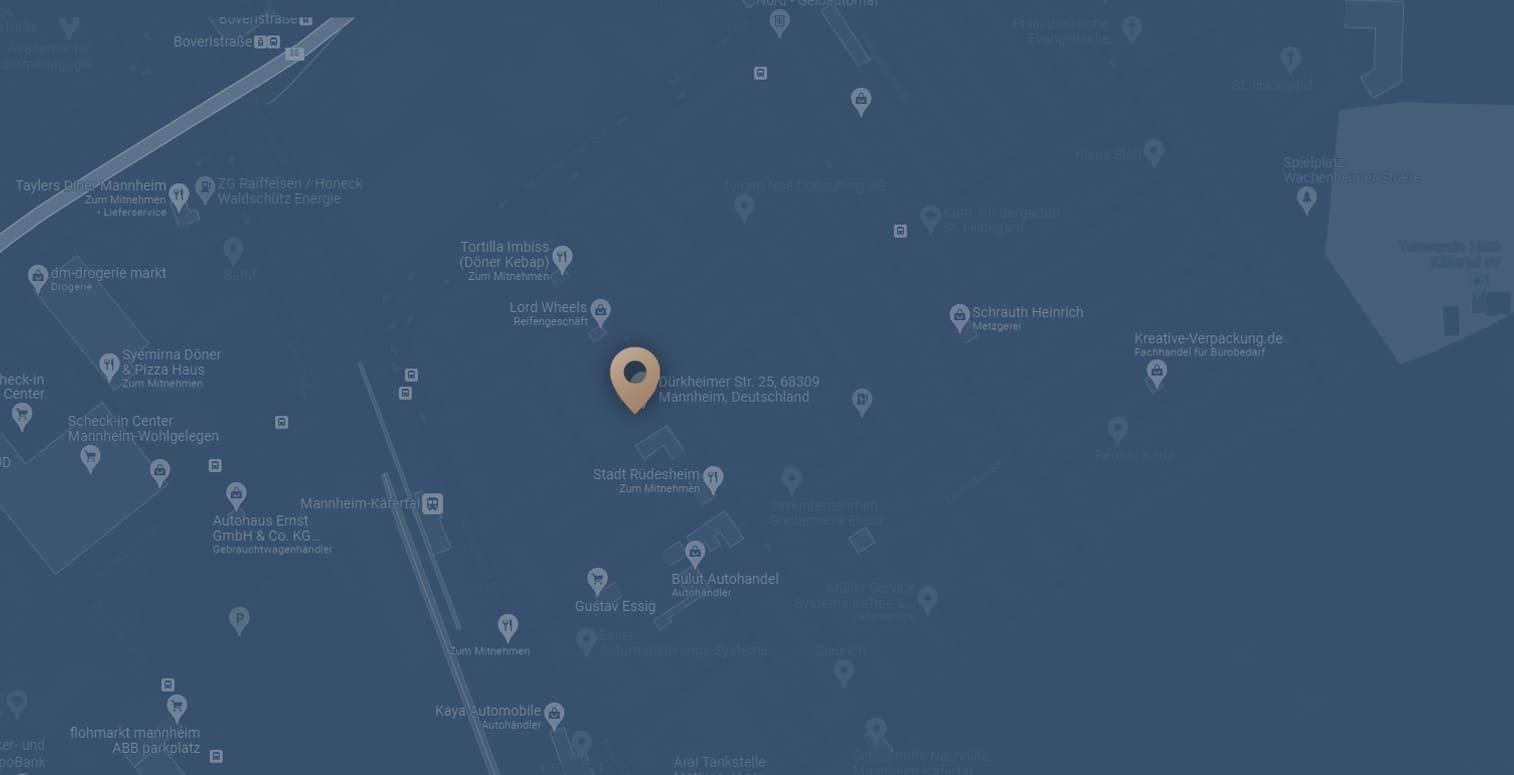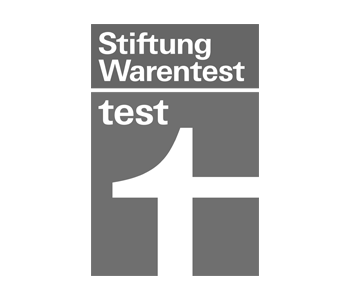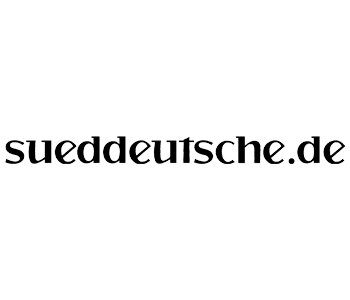Kündigung wegen psychischer Erkrankung
Die Kündigung aufgrund einer psychischen Erkrankung stellt einen besonderen Fall dar, wenn es um krankheitsbedingte Kündigungen geht. Warum? Psychische Erkrankungen sind meist in der Gesellschaft nicht so anerkannt wie körperliche Krankheiten. Oft dauern sie sehr lange und heilen nicht vollständig aus bzw. kommen immer wieder. Sie sind außerdem ein sehr sensibles und ernstzunehmendes Thema. Die meisten Arbeitnehmer möchten zudem keinesfalls mit ihrem Arbeitgeber über ihre Diagnose sprechen. Das müssen Sie auch nicht! In diesem Fall hat der Arbeitgeber lediglich die Möglichkeit, aufgrund eines Verdachts die Kündigung wegen einer psychischen Erkrankung auszusprechen. Dabei handelt es sich dann um eine ordentliche Kündigung. Diese ist personenbedingt.
Hat der Arbeitgeber Kenntnis von Ihrer psychischen Erkrankung? Auch dann ist es notwendig, dass er zunächst eine gründliche Abwägung der Interessen vornimmt. Das bedeutet: Eine Kündigung aufgrund Ihrer psychischen Erkrankung darf erst erfolgen, wenn der Betrieb erheblich darunter leidet und Ihr Arbeitgeber alle milderen Mittel ausgeschöpft hat. Zum Beispiel besteht für Ihren Betrieb ein hoher Leidensdruck, wenn aufgrund Ihrer langen Krankheitsausfälle die Kollegen Überstunden machen oder Leiharbeiter notwendig sind.
Möglicherweise ist Ihre Arbeitsstelle der Grund Ihrer psychischen Erkrankung? Haben Sie zum Beispiel Burnout, weil Sie Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz sind oder die psychische Belastung in Ihrem Arbeitsalltag erheblich ist? Dann stellt vermutlich eine Versetzung ein milderes Mittel dar und verhindert vielleicht einen erneuten Krankheitsausbruch. So ist die Kündigung aufgrund der psychischen Erkrankung abzuwenden. Es kommt bei der Kündigung aufgrund einer psychischen Erkrankung allerdings stets auf den Einzelfall an. Eine pauschale Lösung existiert nicht. Daher ist es wichtig, dass Sie eine arbeitsrechtliche Beratung nutzen. Wir sind jederzeit gerne für Sie da.
Kündigungen sind an sich schon ein belastendes Procedere. Gerade bei Kündigungen aufgrund einer psychischen Erkrankung befindet sich der Arbeitnehmer erst recht in einer Stresssituation. Wir nehmen Ihre Kündigung sehr ernst und unterstützen Sie umfassend. Unsere Anwälte für Arbeitsrecht klären mit Ihnen, wann es sinnvoll ist, Ihre Diagnose beim Arbeitgeber zu thematisieren und welche rechtlichen Möglichkeiten Sie haben, gegen die Kündigung vorzugehen. Beispielsweise haben Sie binnen drei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Kündigung die Möglichkeit, eine Kündigungsschutz-Klage beim Arbeitsgericht einzureichen. Wir beraten und unterstützen Sie stets bei Ihrer Kündigung und kämpfen für Ihr Recht.
Betriebliches Eingliederungs-Management (BEM)
Eine krankheitsbedingte Kündigung ist unwirksam, wenn der Arbeitgeber zuvor kein BEM durchgeführt hat. Sind Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, ist der Arbeitgeber nach § 167 Abs. 2 SGB IX verpflichtet, ein BEM durchzuführen. Das geschieht unabhängig davon, ob er eine krankheitsbedingte Kündigung beabsichtigt oder erwägt. Eine krankheitsbedingte Kündigung ist unverhältnismäßig und damit unwirksam, wenn es angemessene mildere Mittel zur Vermeidung oder Verringerung künftiger Fehlzeiten gibt als die Kündigung.
Für die Verhältnismäßigkeit der Kündigung trägt der Arbeitgeber im Rahmen eines Kündigungsschutz-Prozesses die Darlegungs- und Beweislast. Das bedeutet, dass die Kündigung unwirksam ist, wenn der Arbeitgeber nicht darlegen und beweisen kann, dass es keine anderen angemessenen sowie milderen Mittel gab als die krankheitsbedingte Kündigung. Wurde ein BEM durchgeführt und ist dieses ergebnislos beendet worden? Dann kann der Arbeitgeber dies im Kündigungsschutz-Prozess anbringen. Hier argumentiert er, dass auch ein BEM keine milderen Mittel zu Tage gebracht hat. Gleiches gilt, wenn er das BEM dem Arbeitnehmer angeboten hat, dieser aber abgelehnt oder auf die Einladung zum BEM nicht reagiert hat.
Umgekehrt wirkt es sich aber auf der dritten Prüfungsstufe zu Ungunsten des Arbeitgebers aus, wenn dieser dem betroffenen Arbeitnehmer trotz des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 167 Abs. 2 SGB IX die Durchführung eines BEM nicht angeboten hat. Zwar ist das Anbieten eines BEM keine formelle Voraussetzung für die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung. Das heißt, dass eine krankheitsbedingte Kündigung grundsätzlich auch ohne Anbieten eines BEM wirksam sein kann.
Nach der Rechtsprechung des BAG führt das Unterlassen einer BEM-Einladung im Kündigungsschutz-Prozess aber zu einer Verschärfung der Darlegungs- und Beweislast des Arbeitgebers. Bietet der Arbeitgeber die Durchführung eines BEM nicht an? Dann kann er sich nicht darauf berufen, dass ihm keine alternativen, der Erkrankung angemessenen Einsatz-Möglichkeiten, bekannt waren.Der Arbeitgeber kann sich dann nur noch darauf berufen, wenn er beweisen kann, dass das BEM unter keinen Umständen ein positives Ergebnis hätte erbringen können.
Die vom BAG hierfür aufgestellten Hürden sind hoch. Weshalb ist weder der weitere Einsatz des Arbeitnehmers auf seinem bisherigen Arbeitsplatz noch dessen leidensgerechte Anpassung möglich? Das hat der Arbeitgeber in dem Fall sinnig vorzutragen. Im Streitfall ist das nicht immer einfach zu beweisen. Kann der Arbeitgeber diesen verschärften Anforderungen im Kündigungsschutz-Prozess nicht nachkommen? Dann wird das Arbeitsgericht die krankheitsbedingte Kündigung als unverhältnismäßig und damit als unwirksam einstufen.
Bekannt aus
Wawra & Gaibler Rechtsanwalts GmbH
- Verbraucherschutz und Arbeitsrecht Rechtsanwälte
- Telefon: +49 821 508 788 96
Telefax: +49 821 800 65 600 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 911 2406 1431
Telefax: +49 911 24 06 14 36 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 621 181 459 33
Telefax: +49 621 748 277 94 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de