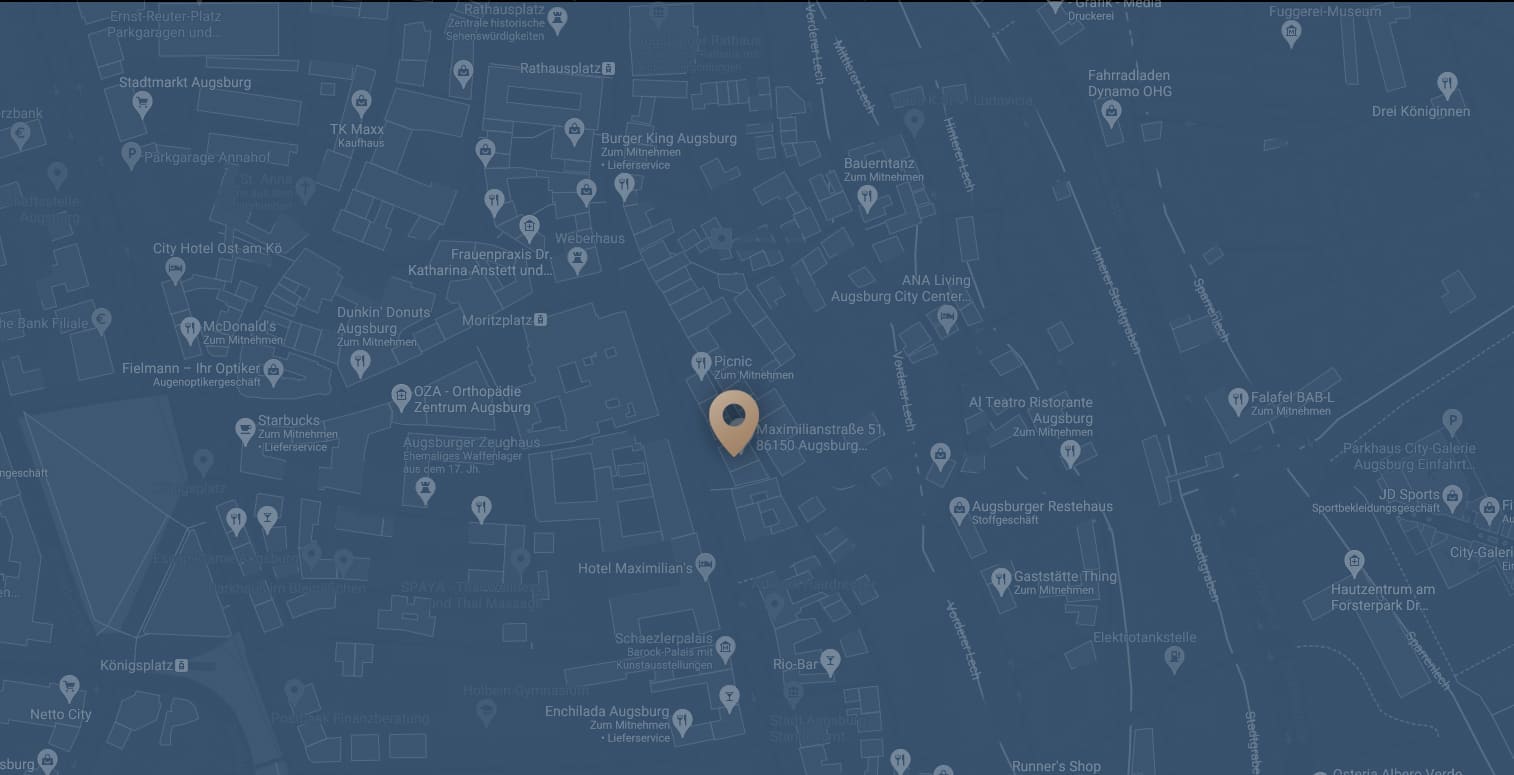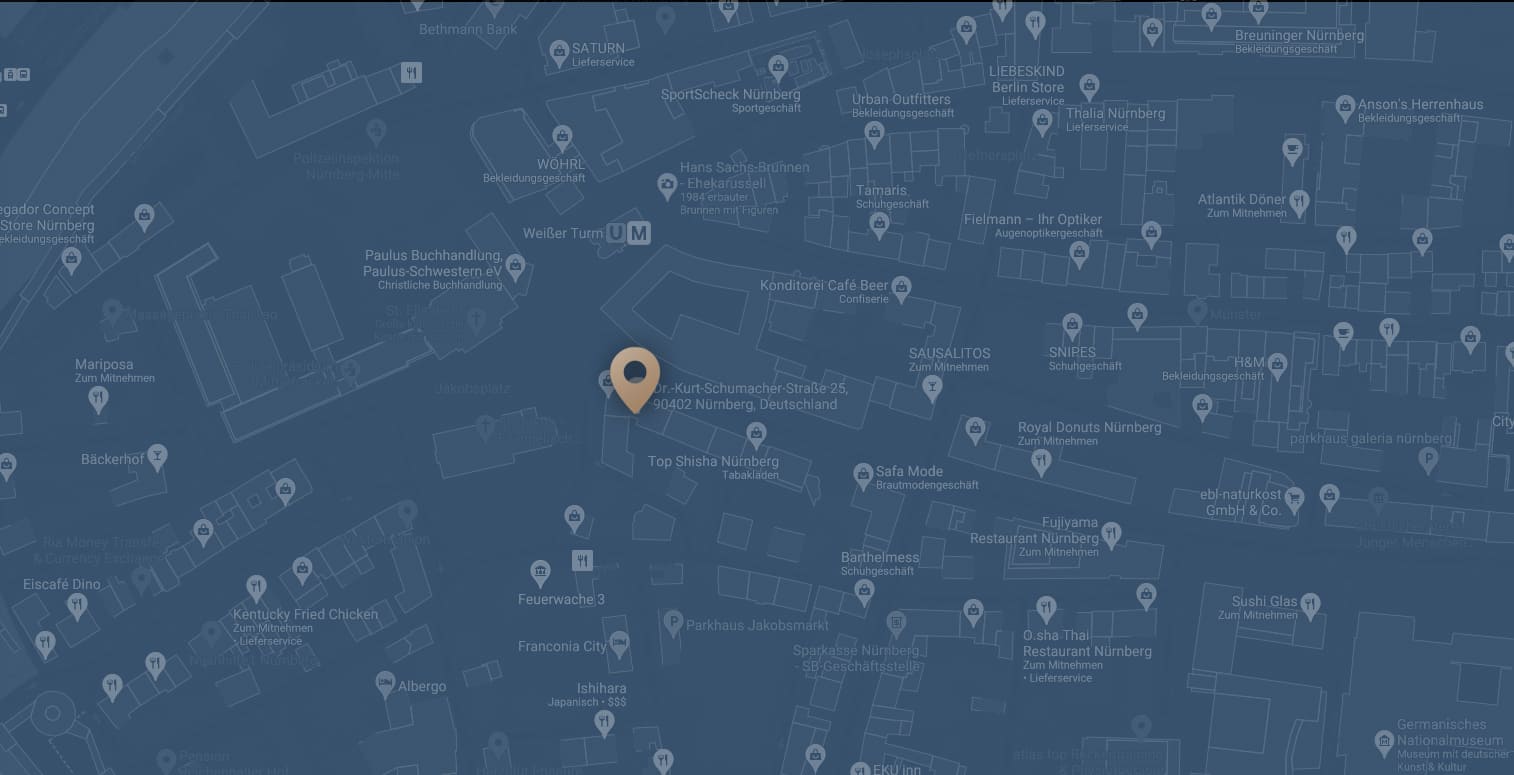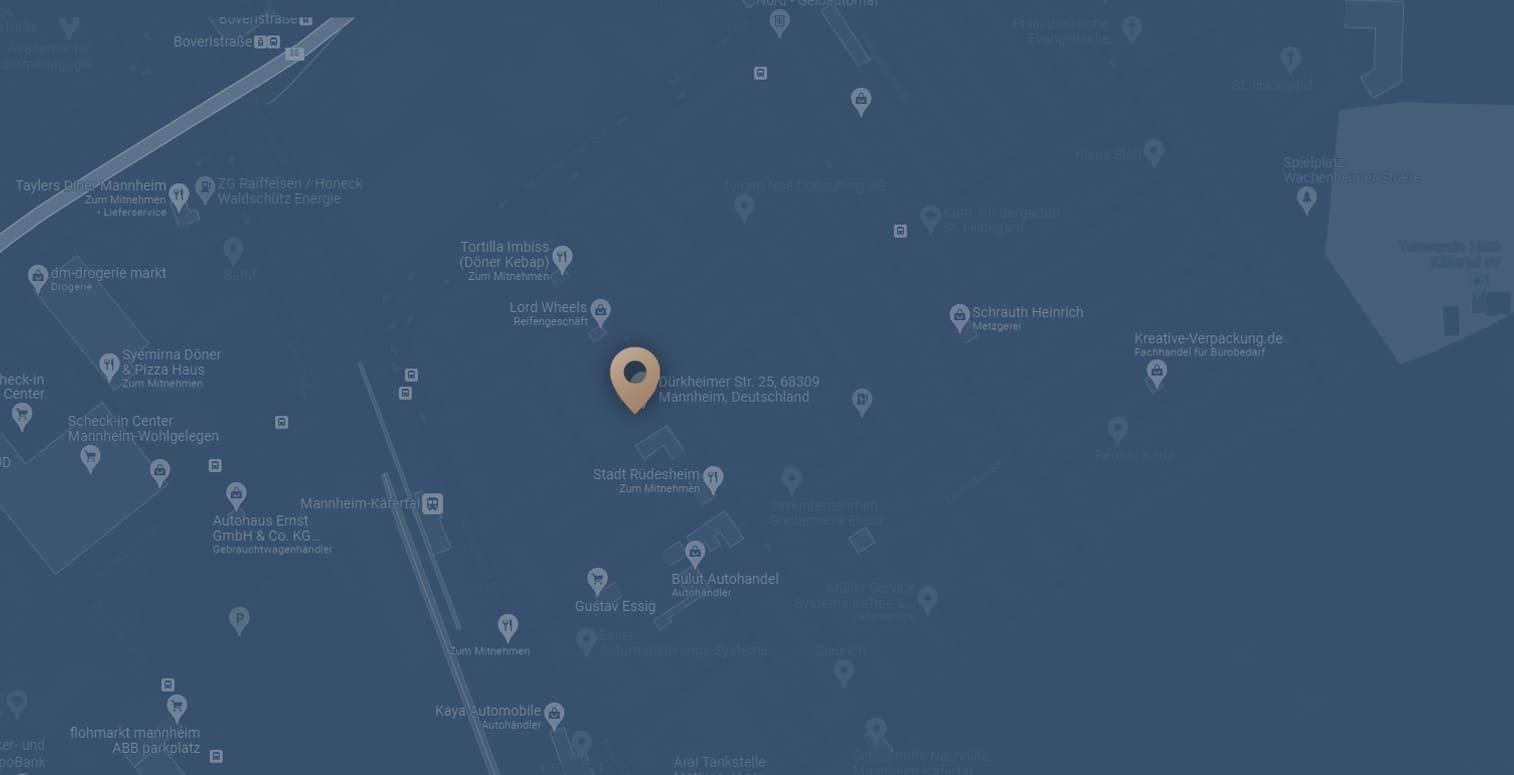Abgasskandal aktuelle Urteile
Neues EuGH- und BGH Urteil 2023 Dieselskandal News / Nachrichten
- ABGASSKANDAL NEUES EUGH- UND BGH URTEIL 2023
- ALLE NEUIGKEITEN ZUM ABGASSKANDAL
- URTEILE ZUM THEMA ABGASSKANDAL
- SEIT 2017 SPEZIALISIERT AUF DEN ABGASSKANDAL
- ERFAHRUNG AUS ÜBER 20.000 DIESELFÄLLEN
- MEHRERE MILLIONEN SCHADENSERSATZZAHLUNGEN UND ABFINDUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN ERSTRITTEN
- KOSTENFREIE & UNVERBINDLICHE ERSTEINSCHÄTZUNG
- BUNDESWEITE VERTRETUNG

Abgasskandal: Neues EuGH- und BGH Urteil 2023. Dieselskandal aktuelle Urteile 2021, 2022 und 2023. BGH- & EuGH Dieselskandal Urteile & News. Urteile im Abgasskandal gegen VW, Audi, Skoda, Daimler / Mercedes, Porsche, Fiat (Wohnmobil), Seat, BMW und Co.
Abgasskandal: Auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Meldungen rund um das Thema Abgasskandal
Betrug am Verbraucher – Dafür steht der Abgasskandal. Doch wie hat die Automobil-Industrie über lange Jahre hinweg ihre Kunden hinters Licht geführt? Und wie steht die Justiz zum Abgasskandal? Bleiben Sie stets informiert über Ihre Rechte. Erfahren Sie hier alles Wichtige und die aktuellen Urteile rund um das Thema Abgasskandal.
Das Wichtigste zum Abgasskandal in Kürze
Im Herbst 2015 deckte die kalifornische Umweltbehörde auf, dass Volkswagen seine Diesel-Fahrzeuge manipulierte. Der Konzern nutzte illegale Abgastechnik. Die Fahrzeuge erscheinen so im Testbetrieb umweltfreundlicher. Im realen Fahrbetrieb stoßen sie jedoch ein Vielfaches der zulässigen Menge an Stickoxiden aus. Der VW-Motor EA 189 sowie sein Nachfolger EA 288 wurden unrühmlich als Skandalmotoren populär. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass auch andere Hersteller ihre Fahrzeuge mit illegalen Abschalt-Einrichtungen ausstatteten, zum Beispiel die Tochterkonzerne von VW. Außerdem betreffen diese Manipulationen längst nicht mehr nur Dieselfahrzeuge, auch Benziner enthalten unzulässige Abgastechnik und sind in den Abgasskandal involviert. Zu den betroffenen Automarken zählen:
- VW
- Audi
- Skoda
- Seat
- Fiat
- Mercedes-Benz
- Porsche
- BMW
- Opel
- Volvo
Vom Abgasskandal sind folglich zahlreiche Fahrzeugbesitzer betroffen. Diese haben nicht das Fahrzeug erhalten, für das sie sich beim Kauf entschieden haben. Schließlich ist anzunehmen, dass die Kaufentscheidung bei den meisten Verbrauchern anders ausgefallen wäre, wenn sie von der Täuschung Kenntnis gehabt hätten. Es lohnt sich für betroffene Fahrzeugbesitzer daher, juristisch dagegen vorzugehen. Schließlich urteilen die Gerichte im Abgasskandal äußerst verbraucherfreundlich. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Rechte geltend zu machen und Schadensersatz zu erhalten.
Welche Arten der Abgastechnik stehen beim Abgasskandal in der Kritik?
Abschalt-Einrichtungen deaktivieren die Abgasreinigung im Fahrzeug. Die Hersteller interessiert lediglich, dass die Abgasreinigung im Prüfzustand, also wenn es um die Zulassung geht, einwandfrei funktioniert. Hierzu verwendet die Automobilbranche unterschiedliche Abgastechniken, die gewährleisten, dass genau das zutrifft.
- Thermofenster: Die Abgasreinigung funktioniert lediglich in einem bestimmten Temperatur-Bereich optimal. Meist liegt dieser bei 20°C und 30°C. Liegt die Außentemperatur außerhalb dieses Bereichs, ist die Abgasreinigung nicht mehr gegeben. In Europa herrschen selten die vorgesehenen Temperaturen. Zum Beispiel liegt diese in Deutschland im Durchschnitt bei 10,5 °C.
- Zeitgesteuerte Abschalteinrichtung: Im Durchschnitt dauert der Prüfmodus 30 Minuten. Das wissen die Fahrzeughersteller. Mit einer zeitgesteuerten Abschalteinrichtung gewährleisten sie, dass das Fahrzeug lediglich in diesem Zeitfenster funktioniert.
- Lenkwinkel-, Kurvenerkennung: Die Software des Motors erkennt, ob es sich beim Fahrtweg um eine reale Straße oder um eine Teststrecke handelt. Demensprechend schaltet sich die Abgasreinigung im regulären Fahrtbetrieb ab.
- Akustikfunktion: Die Akustikfunktion unterdrückt die zu lauten Motorengeräusche. Fahrzeughersteller nutzten sie jedoch auch als illegale Abschalteinrichtung. Im Prüfstand verringert diese den Stickstoffausstoß.
Die wichtigsten Urteile im Abgasskandal
Die Urteile im Abgasskandal fallen in der Regel zugunsten der Verbraucher aus. Das hat zur Folge, dass diese sehr hohe Chancen haben, erfolgreich gegen die Automobil-Industrie vorzugehen und ihre Ansprüche geltend zu machen. Es ist möglich, einen hohen Schadensersatz zu erhalten. Ein Überblick über die wichtigsten Urteile des BGH und EuGH im Abgasskandal:
- BGH-Urteil vom 25.05.2020 (Az. VI ZR 252/19): VW ist zu Schadensersatz verpflichtet aufgrund vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung am Verbraucher. VW verwendete im EA 189 Motor unzulässige Abschalttechnik.
- BGH-Urteil vom 30.07.2020 (Az. VI ZR 367/19): Verbraucher haben auch dann das Recht auf Schadensersatz, wenn der Fahrzeughersteller ein Software-Update anbietet. Schließlich liegt der Schaden bereits beim Abschluss des Kaufvertrags. Denn der Käufer hätte diesen abgelehnt, wenn er gewusst hätte, dass das Fahrzeug in den Abgasskandal verwickelt ist. Es ist für den Fahrzeugbauer daher nicht einfach möglich, diesen Schaden mit einem Software-Update zu beheben.
- BGH-Urteil vom 16.03.2021 (Az. VI ZR 274/20) Verbraucher haben Anspruch auf Rückzahlung der Finanzierungs-Kosten. Der Kläger erhält nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Finanzierungs-Kosten erstattet.
- BGH-Urteil vom 20.07.2021 (Az. VI ZR 575/20): Es besteht auch nach Weiterverkauf eines vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs Anspruch auf Schadensersatz.
- BGH-Urteil vom 16.12.2021 (Az. VII ZR 389/21): Der Verbraucher erhält bei einem Darlehensvertrag trotz Rückgaberecht Schadensersatz, wenn das Fahrzeug in den Abgasskandal verwickelt ist.
- EuGH-Urteil vom 17.12.2020 (Az. C-693/18): Abschalt-Einrichtungen sind grundsätzlich unzulässig, wenn sie im alltäglichen Fahrtbetrieb mehr Stickoxide ausstoßen als im Prüfmodus.
- EuGH-Urteil vom 21.03.2023 (Az. C-100/21): Der Verbraucher hat keine Beweislast mehr. Er hat folglich nicht mehr nachzuweisen, dass es sich um vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung handelt. Fahrlässigkeit beim Verbau illegaler Abgastechnik reicht hierbei völlig aus.
Diese Urteile im Abgasskandal geben den Verbrauchern Rückenwind. Sie haben folglich deutlich höhere Erfolgsaussichten bei einer Klage gegen die Automobilhersteller.
April
2024
08.04.2024 – LG Stuttgart bestätigt Abschalteinrichtungen in Daimler S-Klasse – EUR 7.209,33 nebst Zinsen Schadensersatz
WeiterlesenMärz
2024
25.03.2024 – OLG Nürnberg festigt verbraucherfreundliche Rechtsprechung – Erneut Pauschalschadensersatz nebst Zinsen für BMW-Fahrer
WeiterlesenMärz
2024
21.03.2024 – Erstmals obergerichtlich auch Schadensersatz für Thermofenster in BMW, Typ 318d festgestellt – Pauschalschadensersatz nebst Zinsen als Ausgleichszahlung
WeiterlesenMärz
2024
04.03.2024 – Landgericht Stuttgart verurteilt Mercedes erneut für GLK-SUV – EUR 3.770,00 nebst Zinsen Schadensersatz für Diesel-Fahrer
WeiterlesenFebruar
2024
27.02.2024 – Fiat für Transporter Fiat Ducato vor dem OLG München zu Schadensersatz verurteilt – EUR 2.300,00 nebst Zinsen Ausgleichszahlung für die Klagepartei
WeiterlesenFebruar
2024
21.02.2024 – Oberlandesgericht Koblenz verurteilt VW in II. Instanz für Manipulation an Motor „EA 288“: EUR 1.200,00 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenFebruar
2024
08.02.2023 – OLG Frankfurt bestätigt erstinstanzliche Verurteilung der Audi AG – EUR 48.866,53 Schadensersatz für manipulierten Audi A6
WeiterlesenDezember
2023
18.12.2023 – Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht korrigiert Entscheidung des LG Kiel – EUR 6.190,50 Pauschalschadensersatz
WeiterlesenDezember
2023
13.12.2023 – Mercedes-Benz erneut vor dem Landgericht Stuttgart verurteilt – EUR 2.880,00 Schadensersatz für GLK-SUV
WeiterlesenDezember
2023
12.12.2023 – Opel nun auch vor dem OLG München wegen Abschalteinrichtungen verurteilt – EUR 2.993,00 Schadensersatz für Insignia-Fahrer
WeiterlesenNovember
2023
29.11.2023 – LG Stuttgart sieht Schadensersatzanspruch wegen Kühlmittel-Sollwerttemperatur-Regelung – EUR 2.889,00 Schadensersatz für Mandanten mit Mercedes B 200 CDI
WeiterlesenNovember
2023
15.11.2023 – Mercedes-Benz für schadhaften SUV ML 350 verurteilt – EUR 3.321,33 Schadensersatz für Thermofenster
WeiterlesenNovember
2023
14.11.2023 – Landgericht Gießen verurteilt VW für Manipulation an Motor „EA 288“: EUR 2.103,13 Schadensersatz für unseren Mandanten.
WeiterlesenNovember
2023
07.11.2023 – Mercedes-Benz erneut vor LG Stuttgart wegen Thermofenster verurteilt – EUR 6.172,23 Schadensersatz
WeiterlesenOktober
2023
25.10.2023 – OLG Stuttgart bestätigt in 2. Instanz Urteil des LG Ellwangen – Schadensersatz für Audi A5 Cabrio
WeiterlesenOktober
2023
16.10.2023 – Sensation! OLG Naumburg verurteilt Fiat wegen Capron Wohnmobil in der zweiten Instanz zu EUR 4.835,40 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenOktober
2023
10.10.2023 – Mercedes-Benz erneut vor dem Landgericht Ulm wegen Kühlmittel-Sollwerttemperatur-Regelung verurteilt – EUR 3.752,00 Schadensersatz für Mercedes SUV
WeiterlesenOktober
2023
02.10.2023 – Landgericht Ulm sieht Schadensersatzanspruch wegen Kühlmittel-Sollwerttemperatur-Regelung – EUR 3.970,00 Schadensersatz für Mercedes C-Klasse
WeiterlesenSeptember
2023
26.09.2023 – Landgericht Stuttgart bekräftigt Rechtsprechung bezüglich Thermofenstern in Daimler-Dieselfahrzeugen – EUR 9.169,50 Schadensersatz
WeiterlesenSeptember
2023
25.09.2023 – Landgericht Stuttgart verurteilt Mercedes-Benz zu Vertrauensschadensersatz – EUR 6.149,00 Schadensersatz für manipulierte E-Klasse
WeiterlesenSeptember
2023
11.09.2023 – Landgericht Chemnitz verurteilt WV wegen Thermofenster zu Pauschalschadensersatz – EUR 3.794,12 zugesprochen
WeiterlesenSeptember
2023
05.09.2023 – Erstmalige obergerichtliche Verurteilung der Opel Adam GmbH – OLG Dresden verhilft geschädigtem Dieselfahrer zu Schadensersatz
WeiterlesenSeptember
2023
04.09.2023 – LG München I verurteilt Volkswagen zu Rücknahme von VW Caddy – Restschadensersatz in Höhe von EUR 12.051,74 nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenAugust
2023
18.08.2023 – Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilt Audi für Typ Q3 mit VW-Motor – EUR 18.336,56 nebst Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenAugust
2023
14.08.2023 – Landgericht Augsburg sieht vorsätzliche sittenwidrige Schädigung durch Fiat bei Frankia Wohnmobil – EUR 68.633,86 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenAugust
2023
11.08.2023 – Audi AG nunmehr auch vor dem LG Halle verurteilt – EUR 19.301,43 Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenJuli
2023
27.07.2023 – LG Memmingen bestätigt Rechtsprechung zu Volkswagen-Motor in Audi-Fahrzeugen – EUR 25.065,85 Schadensersatz nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenJuli
2023
26.07.2023 – OLG Stuttgart verurteilt Audi AG zur Zahlung von EUR 61.957,52 – Berufung von Wawra & Gaibler Rechtsanwälte erfolgreich
WeiterlesenJuli
2023
06.07.2023 Abgasskandal: Klausel in Kreditverträgen der Mercedes-Bank für Firmen auch unwirksam
WeiterlesenJuli
2023
05.07.2023 Abgasskandal: Audis Ex-Chef Stadler geht in Revision
WeiterlesenJuni
2023
29.06.2023 Umfrage zum Abgasskandal: Betroffene sind von Klage überzeugt
WeiterlesenJuni
2023
27.06.2023 Abgasskandal: Bewährungsstrafe für Audis Ex-Chef wegen Betrugs
WeiterlesenJuni
2023
27.06.2023 DUH warnt Verbraucher vor Kauf eines gebrauchten Dieselfahrzeugs
WeiterlesenJuni
2023
26.06.2023 Abgasskandal: BGH urteilt - Schadensersatz für alle Dieselfahrer
WeiterlesenJuni
2023
21.06.2023 Abgasskandal: Urteil des BGH mit Spannung am 26. Juni 2023 erwartet
WeiterlesenJuni
2023
15.06.2023 Illegale Abgastechnik: Die Rolle des Thermofensters im Abgasskandal
WeiterlesenJuni
2023
14.06.2023 Abgasskandal: Alarmierend hohe Stickoxid-Emissionen – DUH überführt BMW
WeiterlesenJuni
2023
13.06.2023 – Nunmehr regt auch Oberlandesgericht Rostock gerichtliche Vergleiche bei Volkswagen-Fahrzeugen mit Motor EA 288 an
WeiterlesenJuni
2023
05.06.2023 Endlich offiziell: Kein Dieselskandal, sondern Abgasskandal - Benziner ebenfalls betroffen!
WeiterlesenJuni
2023
02.06.2023 Opel erleidet vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht eine deutliche Niederlage!
WeiterlesenJuni
2023
02.06.2023 – Deutsche Gerichte raten Volkswagen nun zu Vergleichen beim millionenfach verbauten Motor EA 288
WeiterlesenMai
2023
31.05.2023 – Neuerliche Wendung im Dieselskandal: Oberlandesgerichte legen Fahrzeugherstellern Vergleiche nahe
WeiterlesenMai
2023
25.05.2023 – Wawra und Gaibler erstreiten Urteil gegen die Audi AG – EUR 57.670,71 Schadensersatz plus Zinsen zugesprochen
WeiterlesenMai
2023
24.05.2023 – Nun auch Fiat wegen unzulässigem Thermofenster in Wohnmobil verurteilt – EUR 43.696,35 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenMai
2023
19.05.2023 – Mercedes-Benz erneut in Stuttgart wegen Thermofenster verurteilt – EUR 35.836,84 nebst Zinsen als Schadenersatz zugesprochen
WeiterlesenMai
2023
19.05.2023 Abgasskandal - Klage gegen BMW: ADAC-Rechtsschutz zur Kostenübernahme verpflichtet
WeiterlesenMai
2023
19.05.2023 Abgasskandal - Klage gegen VW: Auxilia-Rechtsschutz zur Kostenübernahme verpflichtet
WeiterlesenMai
2023
16.05.2023 – LG Ellwangen bestätigt Rechtsprechung zu Audi-Fahrzeugen mit Volkswagen-Motor EA189 – EUR 11.283,36 Schadensersatz nebst Zinsen für verkauftes Fahrzeug
WeiterlesenMai
2023
16.05.2023 Rupert Stadler, Ex-Chef von Audi, gesteht Fehlverhalten im Abgasskandal
WeiterlesenMai
2023
15.05.2023 – LG Stuttgart verurteilt Mercedes-Benz wegen unzulässigem Thermofenster – Erste Wirkungen des Europäischen Grundsatzurteils
WeiterlesenMai
2023
15.05.2023 – Schadensersatz auch bei bereits verkauftem Fahrzeug – Volkswagen erneut verurteilt
WeiterlesenMai
2023
08.05.2023 - Wegweisende Diesel-Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof: Verwendung eines unzulässigen Thermofensters begründet Anspruch der Verbraucher
WeiterlesenApril
2023
25.04.2023 Abgasskandal: BGH urteilt: Unzulässige Autokredit-Klausel in Verträgen der Mercedes-Benz Bank
WeiterlesenApril
2023
24.04.2023 – LG München II verurteilt Volkswagen zu Rücknahme von VW Tiguan – Restschadensersatz in Höhe von EUR 13.638,80 nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenApril
2023
18.04.2023 Abgasskandal: Landgericht Mannheim verurteilt Fiat zur Rücknahme von schadhaftem Wohnmobil – EUR 40.243,10 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenApril
2023
17.04.2023 – Audi nun auch in Ravensburg für Volkswagen-Motor EA189 verurteilt – EUR 21.446,07 Schadensersatz nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenApril
2023
05.04.2023 Abgasskandal: Verantwortlicher Ingenieur gesteht Manipulation von Dieselmotoren.
WeiterlesenApril
2023
03.04.2023 Abgasskandal: Deutsche Umwelthilfe setzt sich für Nachrüstung oder Stilllegung von 8,6 Millionen Diesel-Pkw ein
WeiterlesenApril
2023
03.04.2023 Neue ICCT-Studie im Abgasskandal: Vermutlich in 150 Dieselfahrzeugen verbotene Abschalteinrichtung verbaut
WeiterlesenMärz
2023
29.03.2023 – OLG Stuttgart stärkt erneut Verbraucherposition – Schadensersatz in Höhe von EUR 28.931,36 bestätigt
WeiterlesenMärz
2023
21.03.2023 EuGH-Sensationsurteil im Diesel-Abgasskandal! Schadensersatz für Verbraucher!
WeiterlesenMärz
2023
09.03.2023 Abgasskandal: Rückruf Mercedes A-Klasse, B-Klasse, CLA und GLA
WeiterlesenFebruar
2023
28.02.2023 – LG Memmingen verurteilt Audi für schadhaften Q3 nach § 852 BGB – EUR 17.883,63 Schadensersatz nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenFebruar
2023
24.02.2023 Die Motoren von VW: Der Skandal-Motor EA 189 und sein Nachfolger
WeiterlesenFebruar
2023
24.02.2023 – Audi vor dem Landgericht Ellwangen zu Schadensersatz in Höhe von EUR 56.447,81 für manipulierten Audi SQ5 verurteilt
WeiterlesenFebruar
2023
24.02.2023 Auch Wohnmobile vom Diesel-Abgasskandal betroffen
WeiterlesenFebruar
2023
24.02.2023 Bosch-Dokumente setzen BMW unter Druck - Verwicklung in Dieselskandal
WeiterlesenFebruar
2023
23.02.2023 – OLG Dresden erhöht Schadensersatz für VW-Golf-Fahrer – Verbraucher erhält insgesamt EUR 15.944,90
WeiterlesenFebruar
2023
17.02.2023: Abgasskandal - LG München urteilt: Autohersteller darf nicht mit irreführenden Abgaswerten werben
WeiterlesenFebruar
2023
10.02.2023 - Dieselfahrverbot in München. Fahrverbot für Euro 4 und Euro 5 Diesel.
WeiterlesenFebruar
2023
07.02.2023 - Fast 60.000 € Schadensersatz für Porsche-Fahrer im Abgasskandal
WeiterlesenFebruar
2023
07.02.2023 - Kraftfahrt-Bundesamt wertet Thermofenster als illegale Abschalteinrichtung
WeiterlesenFebruar
2023
07.02.2023 – OLG Dresden verurteilt Volkswagen zu Schadensersatz in Höhe von EUR 19.623,62 für 2013 gekauften VW Tiguan
WeiterlesenFebruar
2023
02.02.2023 – Volkswagen erneut vor dem Landgericht Augsburg zur Zahlung des „kleinen Schadensersatzes“ verurteilt – Zahlung von EUR 2.469,90
WeiterlesenJanuar
2023
24.01.2023 – LG Augsburg stärkt Anspruch auf sog. „kleinen Schadensersatz“ - Volkswagen zu Restschadensersatz in Höhe von EUR 3.255,08 für nahezu 10 Jahre alten VW Tiguan verurteilt
WeiterlesenJanuar
2023
23.01.2023 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Klagepartei behält Fahrzeug und erhält zusätzlich EUR 2.287,48 nebst Zinsen
WeiterlesenDezember
2022
12.12.2022 – OLG München stärkt erneut Verbraucherrechte – Schadensersatz besteht auch bei bereits verkauften Fahrzeugen
WeiterlesenDezember
2022
09.12.2022 Abgasskandal: Ab Februar 2023: Diesel-Fahrverbot in München
WeiterlesenDezember
2022
07.12.2022 – Volkswagen erneut für Fahrzeug Touran verurteilt – LG Frankenthal bestätigt Schadensersatz in Höhe von EUR 9.691,99 nebst Zinsen
WeiterlesenDezember
2022
02.12.2022 – VW erneut von OLG München verurteilt – Fahrzeug bereits verkauft. Mdt. erhält nachträglich EUR 12.328,21 Schadensersatz
WeiterlesenNovember
2022
28.11.2022 – Volkswagen erneut vor dem OLG Dresden verurteilt: Gericht bestätigt Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung
WeiterlesenNovember
2022
24.11.2022 – Audi Abgasskandal: Schadensersatz auch bei bereits verkauftem Fahrzeug – EUR 7.192,68 Schadensersatz nebst Zinsen
WeiterlesenNovember
2022
23.11.2022 Neues Softwareupdate im VW-Dieselskandal mit negativem Einfluss auf die Langlebigkeit des Fahrzeuges
WeiterlesenNovember
2022
22.11.2022 - Bereits 2006 gaben Audi, VW, Daimler und BMW illegale Abschalteinrichtungen in Auftrag – Neue Beweise im Dieselskandal
WeiterlesenNovember
2022
18.11.2022. – Landgericht Nürnberg-Fürth bestätigt Rechtsprechung bezüglich Volkswagen-Motoren in Audi-Fahrzeugen – EUR 14.474,71 nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenNovember
2022
17.11.2022 – OLG Dresden bestätigt Schadensersatz in Höhe von EUR 12.091,07 für 11 Jahre alten Caddy
WeiterlesenNovember
2022
15.11.2022 – VW-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Landau in der Pfalz verurteilt – Schadensersatz EUR 16.334,83 plus Zinsen
WeiterlesenNovember
2022
10.11.2022 - EuGH: Deutsche Umwelthilfe bekommt Klagerecht im Dieselskandal! Rückrufe und Stilllegungen von Millionen Dieselfahrzeugen drohen.
WeiterlesenNovember
2022
04.11.2022 – Erneut Nichtzulassungsbeschwerde von Volkswagen durch den Bundesgerichtshof zurückgewiesen
WeiterlesenOktober
2022
27.10.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Schadensersatz für über 10 Jahre alten Golf
WeiterlesenOktober
2022
20.10.2022 – Volkswagen haftet für schadhaften VW Tiguan – Landgericht Ravensburg verurteilt wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung
WeiterlesenOktober
2022
13.10.2022 – VW-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Dessau-Roßlau verurteilt – Schadensersatz EUR 13.344,26 plus Zinsen
WeiterlesenOktober
2022
05.10.2022 – OLG München bekräftigt erneut Rechtsansicht im Wohnmobil-Abgasskandal – Fiat in Erklärungsnot
WeiterlesenOktober
2022
04.10.2022 – Volkswagen erneut für manipulierten SEAT Alhambra verurteilt – Schadensersatz EUR 12.859,27 plus Zinsen
WeiterlesenSeptember
2022
30.09.2022 – Auch Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilt Audi für Fahrzeug A5 – EUR 28.632,89 nebst Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenSeptember
2022
29.09.2022 – LG Stuttgart verurteilt Mercedes-Benz wegen unzulässigem Thermofenster – Schadensersatz 26.525,44 Euro nebst Zinsen
WeiterlesenSeptember
2022
27.09.2022 – Abschalteinrichtungen in Audi A5 Cabrio bestätigt – EUR 21.551,23 nebst Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenSeptember
2022
26.09.2022 – Opel ruft neue Fahrzeuge zurück – Software-Update als Abhilfemaßnahme
WeiterlesenSeptember
2022
23.09.2022 – Mercedes-Benz erneut verurteilt: LG Stuttgart bestätigt Abschalteinrichtungen in Mercedes-Benz Vito – Schadensersatz 8.324,37 Euro plus Zinsen
WeiterlesenSeptember
2022
22.09.2022 – LG Stuttgart verurteilt Mercedes-Benz für C 220 D Gebrauchtwagen – Schadensersatz 25.244,87 Euro nebst Zinsen und Freistellung von allen weiteren Darlehensraten
WeiterlesenSeptember
2022
21.09.2022 – Audi erneut für Fahrzeugtyp A6 verurteilt – EUR 55.619,81 Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenSeptember
2022
20.09.2022 – VW-Abgasskandal: Landgericht Regensburg verurteilt Volkswagen für SEAT Alhambra – Schadensersatz EUR 13.875,37 plus Zinsen
WeiterlesenSeptember
2022
15.09.2022 – Weiteres wegweisendes Urteil im FIAT-Wohnmobilabgasskandal erwartet: Auch OLG München kündigt Verurteilung an
WeiterlesenSeptember
2022
12.09.2022 – OLG Stuttgart stärkt erneut Verbraucherposition – Schadensersatz in Höhe von EUR 17.135,81 bestätigt
WeiterlesenAugust
2022
26.08.2022 – Landgericht Ellwangen stärkt Anspruch auf kleinen Schadensersatz – Keine Rückgabe des Fahrzeugs
WeiterlesenAugust
2022
25.08.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Mercedes-Benz E 250 D Gebrauchtwagen – Schadensersatz 4.158,35 Euro nebst Zinsen
WeiterlesenAugust
2022
24.08.2022 – Audi erneut für Fahrzeugtyp A6 verurteilt – EUR 56.540,64 Schadensersatz zuzüglich Zinsen für 10 Jahre altes Fahrzeug zugesprochen
WeiterlesenAugust
2022
19.08.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 25.041,34 plus Zinsen
WeiterlesenAugust
2022
18.08.2022 – Abschalteinrichtungen bei Skoda: Fehlerhaftes Urteil des Landgerichts Augsburg vom OLG München aufgehoben – Schadensersatz ohne Fahrzeugrückgabe
WeiterlesenAugust
2022
17.08.2022 – LG Deggendorf bestätigt Abschalteinrichtungen in Audi Q5 (Motor 3.0 TDI) – Schadensersatz auch bei bereits verkauftem Fahrzeug
WeiterlesenAugust
2022
17.08.2022 – Volkswagen haftet für schadhaften VW Tiguan – Landgericht Ravensburg bestätigt Rechtsprechung
WeiterlesenAugust
2022
12.08.2022 – Verdacht der Abgasmanipulation bei Fiat erhärtet sich – interne Software-Aktion „6042“ bei Euro-6 Wohnmobilen
WeiterlesenAugust
2022
05.08.2022 – Audi für Porsche Macan S verurteilt – EUR 63.001,87 Schadensersatz nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenAugust
2022
05.08.2022 – LG Landshut bestätigt verbraucherfreundliche Rechtsprechung bezüglich Motor EA 189 – Restschadensersatz in Höhe von EUR 29.980,88
WeiterlesenAugust
2022
04.08.2022 – Fiat Chrysler (heute Stellantis) in den USA erneut zu Schadensersatzzahlung in Höhe von 300 Millionen Dollar wegen manipulierter Diesel verurteilt
WeiterlesenAugust
2022
03.08.2022 – Volkswagen erneut vor dem Landgericht Augsburg verurteilt – Restschadensersatz in Höhe von EUR 15.460,83 für 10 Jahre alten VW Tiguan zugesprochen
WeiterlesenAugust
2022
02.08.2022 – Sittenwidrige Schädigung von Verbrauchern durch OLG Stuttgart bestätigt – Schadensersatz EUR 12.959,50 plus Zinsen
WeiterlesenJuli
2022
28.07.2022 – Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz in Höhe von EUR 12.966,90 für 10 Jahre alten VW Tiguan zugesprochen
WeiterlesenJuli
2022
27.07.2022 – Audi vor dem Landgericht Landshut zu Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verurteilt – EUR 32.627,90 Schadensersatz plus Zinsen zugesprochen
WeiterlesenJuli
2022
26.07.2022 – Audi-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Ulm verurteilt – Schadensersatz EUR 26.854,90
WeiterlesenJuli
2022
14.07.2022 – Opel Abgasskandal Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Verden im-Abgasskandal – Schadensersatz 11.241,88 Euro
WeiterlesenJuli
2022
15.07.2022 – Thermofenster seitens des Europäischen Gerichtshofs als unzulässige Abschalteinrichtung qualifiziert
WeiterlesenJuli
2022
14.07.2022 – VW-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Passau verurteilt – Schadensersatz EUR 7.354,17 plus Zinsen für 10 Jahre alten VW Golf
WeiterlesenJuli
2022
12.07.2022 – Fiat nun auch in Österreich wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen verurteilt
WeiterlesenJuli
2022
07.07.2022 – Wawra und Gaibler erstreiten Urteil gegen die Audi AG – EUR 25.016,00 Schadensersatz plus Zinsen zugesprochen
WeiterlesenJuni
2022
28.06.2022 – Mercedes-Abgasskandal: Wawra & Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Mercedes-Benz E 350 Neuwagen – Schadensersatz 41.687,04 Euro
WeiterlesenJuni
2022
24.06.2022 – Abschalteinrichtungen in Audi A5 Cabrio (Motor 3.0 TDI) bestätigt – EUR 38.422,12 Schadensersatz plus Zinsen zugesprochen
WeiterlesenJuni
2022
21.06.2022 – LG Dresden bestätigt erneut Abschalteinrichtungen in VW Caddy - Schadensersatz EUR 17.914,04 plus Zinsen
WeiterlesenJuni
2022
15.06.2022 – Mercedes-Abgasskandal: LG Stuttgart bestätigt Abschalteinrichtungen in Mercedes-Benz A-Klasse – Schadensersatz 14.464,71 Euro
WeiterlesenJuni
2022
14.06.2022 – Fiat Abgasskandal Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Augsburg im Wohnmobil-Abgasskandal – Schadensersatz 48.082,00 Euro
WeiterlesenJuni
2022
14.06.2022 – OLG München bestätigt erneut Rechtsansicht von Wawra und Gaibler zu Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 7.808,22
WeiterlesenJuni
2022
09.06.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Schadensersatz für 10 Jahre alten Golf
WeiterlesenJuni
2022
08.06.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz in Höhe von EUR 23.678,63 zugesprochen
WeiterlesenJuni
2022
07.06.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz in Höhe von EUR 11.873,30 nach §852 BGB zugesprochen
WeiterlesenJuni
2022
02.06.2022 - EuGH-Generalanwalt: Erwerbern eines Diesel-Fahrzeugs mit unzulässiger Abschalteinrichtung (z. B. Thermofenster) steht Schadensersatzanspruch gegen Hersteller zu
WeiterlesenJuni
2022
02.06.2022 – VW-Urteil: Skoda erneut für Motor EA 189 verurteilt– Restschadensersatz nach §852 BGB in Höhe von EUR 18.877,26 zugesprochen
WeiterlesenMai
2022
30.05.2022 – Mercedes-Abgasskandal: Wawra & Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Mercedes-Benz Roadster – Schadensersatz 23.745,42 Euro
WeiterlesenMai
2022
27.05.2022 – Abschalteinrichtungen bei Skoda: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil vor dem OLG Dresden – Schadensersatz EUR 5.774,83
WeiterlesenMai
2022
24.05.2022 – VW Abgasskandal: LG Ellwangen stärkt Anspruch auf kleinen Schadensersatz – Keine Rückgabe des Fahrzeugs
WeiterlesenMai
2022
18.05.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 23.604,38 plus Zinsen
WeiterlesenMai
2022
19.05.2022 – LG Tübingen bestätigt Abschalteinrichtungen in VW Touran – EUR 17.135,81 Schadensersatz nebst Zinsen zugesprochen
WeiterlesenMai
2022
17.05.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil für VW Beetle – Schadensersatz EUR 15.819,14 plus Zinsen
WeiterlesenMai
2022
12.05.2022 – OLG München bestätigt Rechtsansicht von Wawra & Gaibler und weist Berufung von Audi zurück – EUR 36.662,57 Rückzahlung den Kunden und Freistellung von allen zukünftigen Raten gegenüber der Audi Bank – Schadensersatz insgesamt ca. EUR 66.500,00
WeiterlesenMai
2022
10.05.2022 – Abschalteinrichtungen in Audi A6 (Motor 3.0 TDI) bestätigt – EUR 38.237,98 Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenMai
2022
09.05.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz nach §852 BGB zugesprochen
WeiterlesenMai
2022
05.05.2022 – Fiat erneut wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen verurteilt
WeiterlesenMai
2022
05.05.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 16.613,91 plus Zinsen
WeiterlesenMai
2022
03.05.2022 – VW Abgasskandal: Schadensersatz auch bei bereits verkauftem Fahrzeug – Volkswagen erneut verurteilt
WeiterlesenApril
2022
27.04.2022 – VW-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Dresden erneut verurteilt – Schadensersatz EUR 14.382,78 plus Zinsen für 11 Jahre alten VW Caddy
WeiterlesenApril
2022
25.04.2022 – Wawra & Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 20.094,42 plus Zinsen
WeiterlesenApril
2022
22.04.2022 – Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilt Volkswagen für Seat Alhambra – Schadensersatz EUR 17.396,58 plus Zinsen
WeiterlesenApril
2022
22.04.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz nach §852 BGB zugesprochen
WeiterlesenApril
2022
14.04.2022 – Audi-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA189 nach Musterfeststellungsklage
WeiterlesenApril
2022
14.04.2022 – Mercedes-Abgasskandal: Wawra & Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Mercedes-Benz GLK 220 CDI Gebrauchtwagen – Schadensersatz 23.692,40 Euro
WeiterlesenApril
2022
14.04.2022 – VW-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Dresden verurteilt – Schadensersatz EUR 22.067,49 plus Zinsen
WeiterlesenApril
2022
13.04.2022 – Audi-Abgasskandal: Volkswagen vom Landgericht Ulm verurteilt – Schadensersatz EUR 26.179,48
WeiterlesenApril
2022
06.04.2022 – Audi-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA896 (Audi A4 - 3.0 Liter) – EUR 21.247,91 Schadensersatz zugesprochen
WeiterlesenApril
2022
04.04.2022 – Audi-Abgasskandal: Volkswagen erneut vom Landgericht Ellwangen verurteilt – Schadensersatz EUR 33.370,56
WeiterlesenMärz
2022
30.03.2022 – Audi-Abgasskandal: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil vor dem OLG München für Motor EA 189 – Schadensersatz EUR 23.190,60
WeiterlesenMärz
2022
29.03.2022 – VW Abgasskandal: Schadensersatz auch bei bereits verkauftem Fahrzeug – Volkswagen erneut verurteilt
WeiterlesenMärz
2022
23.03.2022 - Die neuen Zwangsrückrufe und der Abgasskandal bei Opel im Detail
WeiterlesenMärz
2022
23.03.2022 – Mercedes-Abgasskandal: Wawra & Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Mercedes-Benz C 220 D Gebrauchtwagen – Schadensersatz 22.707,96 Euro
WeiterlesenMärz
2022
22.03.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil für Motor EA 189 – Restschadensersatz nach §852 BGB zugesprochen
WeiterlesenMärz
2022
21.03.2022 - Audi erneut wegen unzulässigen Abschalteinrichtungen verurteilt
WeiterlesenMärz
2022
18.03.2022 - Mercedes Urteil: Wawra und Gaibler erreichen Zuspruch vor dem LG Stuttgart für laufenden Darlehensvertrag - Schadensersatz 23.328,84 Euro + Freistellung von allen Darlehensraten!
WeiterlesenMärz
2022
07.03.2022 - Weitere Rückrufe bei Opel: Opel ist tiefer im Abgasskandal verwickelt als bisher öffentlich bekannt
WeiterlesenMärz
2022
02.03.2022 - VW-Urteil: Wawra und Gaibler erzielen sensationellen Erfolg für Volkswagen Kunden - Auto bereits verkauft, nachträglicher Schadensersatz i.H.v. 9.353,42 Euro für den Kunden!
WeiterlesenMärz
2022
02.03.2022 - Audi Abgasskandal Urteil: Wawra und Gaibler erzielen Urteil vor dem Landgericht Dresden für 3,0 l V6 TDI Motor - Schadensersatz 49.678,14 Euro
WeiterlesenFebruar
2022
23.02.2022 - BGH-Urteil vom 21.02.2022: Ansprüche im Dieselskandal bis zu 10 Jahre nach Kauf durchsetzbar
WeiterlesenFebruar
2022
21.02.2022 – VW-Urteil: Wawra und Gaibler erzielen sensationellen Erfolg für Volkswagen Kunden – Verjährung der Ansprüche gegen viele weitere Hersteller erst 10 Jahre nach Kauf! Schadensersatz 9.246,40 Euro
WeiterlesenFebruar
2022
21.02.2022 – OLG München bestätigt Rechtsansicht von Wawra und Gaibler zur Verjährung
WeiterlesenMärz
2022
16.03.2022 - VW-Urteil: Wawra und Gaibler erzielen Erfolg für Volkswagen Kunden - Verjährung der Ansprüche gegen viele weitere Hersteller erst 10 Jahre nach Kauf! Schadensersatz 12.607,06 Euro
WeiterlesenMärz
2022
09.03.2022 - Mercedes Abgasskandal Urteil: Wawra und Gaibler erstreiten Urteil vor dem LG Stuttgart für Motor OM 651 (EU6) - Schadensersatz 9.945,03 Euro
WeiterlesenMärz
2022
09.03.2022 - VW Urteil: Wawra und Gaibler erzielen Urteil für Motor EA 189 - Verjährung der Ansprüche erst 10 Jahre nach Kauf! Schadensersatz 9.965,06 Euro
Weiterlesen Wawra & Gaibler Rechtsanwalts GmbH
- Verbraucherschutz und Arbeitsrecht Rechtsanwälte
- Telefon: +49 821 508 788 96
Telefax: +49 821 800 65 600 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 911 2406 1431
Telefax: +49 911 24 06 14 36 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de
- Telefon: +49 621 181 459 33
Telefax: +49 621 748 277 94 - E-Mail: office@anwalt-verbraucherschutz.de